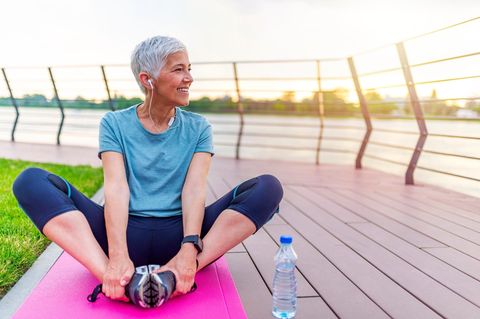Christoph Schlingensief: Bilder eines Künstlerlebens
Christoph Schlingensief: Bilder eines Künstlerlebens
image
Wie jeden Morgen stand sie in der Dunkelheit auf und weckte das Mädchen. Gemeinsam schürten sie das Feuer: drei Stellen nebeneinander für drei schwere verzinkte Töpfe. Sie kochten schweigend, bis die Sonne schräg über dem Reet der Hütten stand: Reis, Bohnen, Soße aus Tomaten, Zwiebeln, Kurkuma und Piment. Das Mädchen lief los, um den Esel zu holen, der trotz seiner zusammengebundenen Vorderbeine weit hinaus in die Savanne gehüpft war. Denise Compaoré füllte in der Zeit das Essen in große bunte Plastikschüsseln, bedeckte diese mit bunten Tüchern und lud alles in den Handwagen. Dann spannte sie das Tier an. Noch einen Klaps für den Esel, ein mahnendes Wort für die Tochter. "Pass auf das Geld auf", sagt sie, und wie immer nickt das Mädchen nur müde.
Das Mädchen ist fort, die alte blinde Tante, die jeden Tag im Mauerschatten vor dem Tor sitzt, ruft nach Essen. Denise schürt die Feuer neu, die Sonne steht schon hoch, und sie schwitzt über die Flammen gebeugt. Ihre Oberarme sind muskulös vom Tragen der Holzscheite, vom Rühren in den großen Töpfen. Noch einmal sechs Kilo Reis, vier Kilo Bohnen, noch einmal einen Topf voller Soße anrühren, diesmal mit großen Kohlstücken. "Mama Denise", haben die Arbeiter gesagt, "mach Kohl in die Soße, sonst essen wir nicht bei dir."
image
Vier Tage war die Baustelle verlassen. Vier Tage ohne Lohn. Gestern, als sie die Waren für den heutigen Tag einkaufte, hat sie um Kredit bitten müssen. Sieben Euro hat sie ausgegeben, und wenn heute und in den folgenden Tagen nicht genügend hungrige Arbeiter auf der Baustelle sind, kann sie in diesem Monat das Schulgeld für die Söhne nicht mehr zahlen. Sie bauen eine Schule. Das haben die Arbeiter ihr gesagt. Dass weiße Menschen vor Ort sind und Befehle erteilen, ist in Denise’ Heimatland, in Burkina Faso, nichts Ungewöhnliches. Der westafrikanische Staat ist einer, der in internationalen Berichten gern mit Abkürzungen belegt wird. Ein HIPC, welches im HDI so ziemlich an letzter Stelle steht. Also eines der Highly Indebted Poor Countries (hoch verschuldetes armes Land), das auf dem Human Development Index, einer Skala für Entwicklungsfortschritte, auf Platz 174 von 177 zu vergebenden steht. Ärmer kann man fast nicht mehr sein.
La Site, die Baustelle, sagte Denise zu diesem Ort. 15 Hektar Savanne, bedeckt von hart gebackenem rotem Sand, von Akazien und Karitébäumen, von Granitfelsen, die aussehen wie schlafende Tiere. Was für Denise nur ein weiteres Entwicklungshilfeprojekt ist, wird in Deutschland seit geraumer Zeit als europäisch-afrikanische Symbiose gefeiert. Hier, auf einem 30 Kilometer nordöstlich von der Hauptstadt Ougadougou gelegenen Plateau, lässt ein deutscher Theaterregisseur, Autor, Filmemacher eine Oper, ein ganzes Operndorf inklusive Hospital und Schule bauen. An diesen Ort träumte sich im vergangenen Jahr das deutsche Feuilleton und beschrieb ein afrikanisches Arkadien: die perfekte Kulisse, um durch Kunst zu vereinen, was in der Wirklichkeit getrennt ist.
Es gibt kein Wort für Opernhaus in der Sprache der Menschen in Burkina Faso.
In Denise’ Sprache, dem Mòoré der Mossi, gibt es für Oper keine Übersetzung. Für Gesang, für Tanz, das wohl. Aber warum braucht man dafür ein Haus, ein Dach darüber, wenn man auch im Schatten der Dornakazien tanzen und die nackten Füße in den warmen Sand stampfen kann? Und wie kann man ein ganzes fertiges Dorf bauen, wenn ein Dorf doch über Generationen wächst und jedes Gehöft erst durch die Kinder und Enkel vergrößert wird?
Denise Compaoré ist 53 Jahre alt. Die fünf Jahrzehnte sieht man ihr nicht an. Gerade hält sie ihren Rücken, beherrscht und mit glatter Haut ist ihr Gesicht. Ihr Nachname lautet wie der des Präsidenten von Burkina Faso: Blaise Compaoré. Ein direkter Verwandter ist der nicht, denn wäre er es, Denise hätte wohl ausgesorgt. Sie müsste nicht in diesem Kaff Tamissi, nicht auf dem Hof ihres Bruders wohnen. Sie lebte noch immer in der Stadt und hätte ihren kleinen Laden. Beides, den Laden und das Stadtleben, hat sie aufgegeben, als ihr Mann vor 13 Jahren bei einem Autounfall ums Leben kam und sie mit drei Kindern dastand. Da ging sie wieder in ihr Heimatdorf und nahm, was die Familie ihr gab.
image
Bis die Weißen kamen und mit dem Bauen begannen, verkaufte Denise ihr Essen auf dem nächstgelegenen Markt, zwei Kilometer entfernt. Erst als ein Lastwagen nach dem anderen anrollte und bunte riesige Container mitten in der Savanne abgestellt wurden, als man in Timissi bekannt gab, man suche nach Bauarbeitern, und sich der König aus seinem Dorf Tambeyorgo aufmachte und dem Bauvorhaben seinen Segen gab, begriff Denise, dass sich ihr eine neue Verdienstmöglichkeit eröffnete. Fortan schickte sie ihre 14-jährige Tochter Mariam auf den Markt, kochte morgens zweimal, wusch sich dann, band einen sauberen Rock um und trieb ihren Esel dorthin, wo in der heißen Sonne die Ziegel buken.
Tamissi ist ein stiller Ort, bewohnt von 70 Familien, jede in ihrem eigenen Rund aus Hütten, umgeben mit einer Mauer aus Lehm. Immer stehen die Tore offen, damit jeder hinein- und wieder hinausgehen kann, auch die Ziegen, die Esel, die Rinder, die der einzig mögliche Reichtum sind. Geld ließ sich in Tamissi nie verdienen, was man braucht, wird getauscht. Ein Stück Stoff gegen zehn Ziegel, eine Medizin gegen eine Strohmatte für das Dach. Nur wer mehr anbaut, mehr Mais, Sorghum, Tomaten, Cassava, als er und die Seinen essen, kann den Überschuss für wenig Geld auf dem Markt verkaufen.
Im Nachbardorf Tambeyorgo sitzt Naba Baongo wie jeden Mittag im Schatten der Nordmauer seines Gehöfts. Naba ist ein Ehrentitel und bedeutet so viel wie König. Naba Baongo hat die Oberherrschaft über seine Leute und das Land, auf dem sie leben. Auch über jenes, welches nun die Weißen bebauen mit diesem Ding, dessen Sinn er nicht versteht und in welches er seine älteste Frau Tiendregeogo Tielbaremba zum Tanz führen wird, wenn es fertig ist.
image
Für Naba Baongo war es keine Überraschung, als die Weißen kamen. Sein Vater hatte ihm vor 76 Jahren bereits gesagt, an diesem Ort werde etwas Besonderes geschehen. Und ihm wohlweislich auch gleich eingeschärft, welche Art von Opfer er dann bringen müsse. Keinesfalls ein rotes Huhn, denn ein rotes Huhn bedeute Blut, nur weiße Hühner könnten den Geist dieses Ortes besänftigen.
Es war im Januar dieses Jahres, als der schwarze Architekt der weißen Männer die Könige und Chefs zusammenrief. "Ihr werdet Geld verdienen", hatte dieser Francis Keré gesagt, und sie haben ihm vertraut, weil er einer von ihnen ist, ein Mossi. Er bat sie, ihre Zustimmung zu geben, und Naba Baongo bat er, den Ort von allem Bösen zu reinigen. Der König musste damals nicht lange überlegen. Zwar sagt er, die Weißen seien nicht so klug wie die Mossi, die keine Schrift hatten und ihr Gedächtnis schulten, indem sie jede Erzählung behielten und weitertrugen, aber die Weißen hätten Macht, weil sie Geld besäßen. Und davon, dass ein Weißer etwas wünscht und man es ihm abschlagen könnte, hat Naba Baongo noch nie gehört. Seinen Segen hat er im Tausch für eine Straße, Wasser und Elektrizität für Tambeyorgo gegeben. Er hätte auch Geld nehmen können, doch die weißen Männer in seiner Schuld zu haben gibt ihm mehr Handlungsspielraum. Naba Baongo möchte gern teilhaben an dem Wohlstand, den die Fremden mit ihren Autos und großen Fernsehkameras, ihren Sonnenschirmen, Zigaretten, Coladosen und ihren dünnen Public-Relation-Frauen in die Savanne tragen. Von Public Relation hat Naba Baongo zwar so wenig gehört wie von Oper. Aber er weiß, dass reiche Frauen dick werden und noch reichere wieder dünn, "weil sie vom Geld so gesättigt sind, dass sie kein Essen mehr brauchen". Wenn die Weißen ihr Versprechen nicht erfüllen, kann er jederzeit die Geister wieder heraufbeschwören, und dann werden die Ziegel bröseln, das Fundament brechen, die Arbeiter verunglücken.
Es ist elf Uhr, als Denise Compaoré ihr Dorf mit Esel und Wagen verlässt. An ihrer Seite die junge Nadesh Ouedrago, die Schönste im Dorf. Zehnmal am Tag fährt Nadesh mit Blechtonnen voller Wasser auf die Baustelle, ihre Tochter Salesh auf den Rücken gebunden. Auch Karim, ihr Mann, hat dort Arbeit gefunden. Für Nadesh bedeutet die Baustelle Freiheit von den täglichen Pflichten, die ihr als Schwiegertochter der Familie obliegen. Zwar muss sie das Geld abgeben, aber "nicht mehr die langweilige Arbeit tun".
Weit fährt Denise mit ihrem Karren nicht. Von allen Seiten kommen die Frauen von Timissi gelaufen, Plastik- und Emailleschüsseln in der Hand, selbst im ärmsten Gehöft, dort wo die nomadisierenden Peul wohnen, der zahnlose alte Salu Dijalu, gönnt man sich an diesem Tag eine Portion Reis mit Bohnen. Schon ist die Sonne über dem Zenit, als Denise auf der Baustelle eintrifft. Sie stellt ihre Schüsseln unter einem Dach aus dicken Strohmatten auf und wischt mit der Hand den Staub aus den mitgebrachten Blechnäpfen. Für sieben zusätzliche Cent verkauft sie heute Sardinen, doch kaum einer der Männer hat so viel Geld dabei.
image
Unter einem anderen Strohdach steht der Architekt Francis Keré über die Pläne gebeugt und malt mit schnellen Bewegungen die Änderungswünsche des Bauherrn ein, der zu Besuch war. Keré ist gerade aus seiner Wahlheimat Berlin eingeflogen und trägt Hemd und Jeans vom Designer. Neben seinem Bauleiter - im zerrissenen Hemd und mit verblichener Hose - sieht er aus wie aus einer anderen Welt. Nur der Schweiß, der rinnt ihm wie allen anderen auch über das Gesicht. Seit er als der Architekt des Regisseurs bekannt ist, findet er keine Ruhe mehr. Fernsehteams und Reporter rücken ihm auf den Leib. Wenn er gewusst hätte, was auf ihn zukommt, nicht nur an Unruhe und Arbeit, sondern auch an deutscher Launenhaftigkeit und an Druck, er hätte niemals Ja gesagt. Der kranke Bauherr will Tempo, will die Mauern wachsen sehen, die Arbeiter mahnen zur Ruhe, die Ziegel müssen trocknen, die Geister dürfen nicht geweckt werden, der afrikanische Tag hat seinen eigenen Rhythmus. Bald beginnt die Regenzeit, dann bilden sich auf der ausgetrockneten Erde Sturzbäche, bis alles nur noch Schlamm ist. Wenn alles gut geht, sind das Privathaus des Bauherrn, die Schule Ende des Jahres fertig, werden dort, wo jetzt nur Staub ist, Foyer und Saal stehen. Wenn alles schiefgeht, ist die Fallhöhe für Keré sehr hoch. "Ich will nur zeigen, dass ich aus Lehm Opern bauen kann. Aber die Welt da draußen giert nach Sensationen." Als Burkiner hat Keré einiges zu verlieren. Nicht nur den Dorfbewohnern gegenüber steht er in der Pflicht. Auch den Ministern seines Landes, die sich Tourismus vom Festspieldorf versprechen und bei denen er um Unterstützung ersuchte. Ob er den Film "Fitzcarraldo" kenne, haben ihn seine Freunde gefragt und ein wenig mitleidig gelacht.
Welche Schnittmenge gibt es zwischen Denise und den Weißen?
Denise weiß nichts von den Ideen, mit denen die Weißen aus ihren klimatisierten Wagen steigen und die sie über das Feld wehen lassen, als sei es ein neuer Wind. Die Begriffe aus der Sprache des deutschen Bildungsbürgertums, der ideologische Überbau des Projekts lassen sich nur schwer ins Mòoré übersetzen und sagen ihr nichts. Das Fenster, durch welches Europa Afrika und Afrika Europa sehen kann – so wünschte es sich der Bauherr -, ist für sie ein beschlagenes. Selbst wenn sie wüsste, dass die Weißen, wenn sie die heiße Baustelle verlassen und in die Stadt zurückfahren, in Hotels wohnen, in denen selbst im Garten Ventilatoren stehen, die kalte Luft und kühlendes Wasser versprühen, es föchte sie nicht an, denn eine Schnittmenge zwischen ihrem Leben und jenem der Weißen gibt es sowieso nicht. Was immer das fertige Festspielhaus sein wird – elitäre Selbstverwirklichung eines Mannes, der mit seiner Sterblichkeit haderte, oder ein ambitioniertes Künstlerprojekt, das die Zukunftslosigkeit der Jugend in den Dörfern mildert -, Denise wird so oder so nicht daran teilhaben. Wenn die Gebäude fertig sind, ziehen die Arbeiter ab, und die Touristen und Kulturschaffenden, die man erwartet, werden ihren Reis mit Bohnen kaum essen.
Es ist drei Uhr, als Denise ihre Schüsseln wieder auf den Wagen lädt und die Reste mit den Tüchern bedeckt. Die Männer haben die Mittagshitze im Schatten verdöst, nun beginnt die Arbeit wieder. Denise zählt ihre Münzen. 27 Essen hat sie verkauft, gut vier Euro eingenommen. Nur wenn die Tochter auf dem Markt gut verkauft hat, wird Denise die sieben Euro Einkaufskosten an diesem Tag decken können.
Als sie, nach einem Umweg über den nächstgelegenen Markt, zu Hause ist, geht die Sonne schon unter. Über die Reste des Essens freuen sich die Söhne, der Bruder mit seiner Frau und seinen Kindern. Bevor sie ins Bett geht, holt Denise das batteriebetriebene Radio aus ihrer Hütte und drückt es dem Sohn in die Hand. "Finde mal etwas, was sie auf Französisch l’ópera nennen", sagt sie zu ihm. Und dann lachen sie lange über die absurde Idee, dem alten Schrottradio ließe sich etwas mit einem so komplizierten Namen entlocken.
Das Festspieldorf von Laongo
Das Festspieldorf von Laongo, wie das Projekt nach dem größten Dorf der Gegend heißt, ist eine Idee des deutschen Theaterregisseurs Christoph Schlingensief. Der Künstler reiste im Sommer 2009 durch Afrika, um einen Ort für seine Idee zu finden, eine Oper zu bauen, dazu eine Schule, in der auch künstlerische Workshops veranstaltet werden. In Burkina Faso wurde er fündig und pachtete vom Staat 15 Hektar Land. Im Februar dieses Jahres war die Grundsteinlegung. Zusätzlich zur Schule und zum Festspielhaus sollen dort eine Krankenstation, ein kleines Hotel sowie Häuser für Ansiedlungswillige entstehen, auch ein Haus für den Regisseur. Finanziert wird das Festspielhaus durch Privatspenden sowie mit Geldern des Auswärtigen Amtes und deutscher Kulturstiftungen.
Christoph Schlingensief starb am 21. August 2010, kurz vor seinem 50. Geburtstag, an Krebs.